KASTELEWICZ music in progress forscht zu musikwissenschaftlichen Themen.
Musik, Kultura und kulturelle Betätigung in den Speziallagern der sowjetischen Besatzungsmacht 1945 – 1950 in der SBZ bzw. DDR

©
Award of Excellence 2023
Anna Barbara Kastelewicz
Preis für die besten Dissertationen
Ausgelobt vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Österreich.
Die Preisverleihung fand am 07. Dezember 2023 in Wien statt.
Anna Barbara Kastelewicz im Portät bei DrehPunktKultur
Bericht der Mozarteum University zur Preisverleihung
Musik, Kultura und kulturelle Betätigung in den Speziallagern der
sowjetischen Besatzungsmacht 1945 – 1950 in der SBZ bzw. DDR
Universität Mozarteum Salzburg
Wissenschaftliches Doktoratsstudium – Musikwissenschaft
Dipl. Orch.Mus., Dipl. Instr.Päd. Anna Barbara Kastelewicz, BMus, PhD
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 1945 errichtete die sowjetische
Besatzungsmacht in Deutschland auf dem Gebiet ihrer Besatzungszone (SBZ), der
späteren DDR, zehn Gefangenenlager, die sie unter der Bezeichnung
„Speziallager“ führte. In diesen Lagern hielt sie zunächst vorwiegend NS-belastete
Personen, bald aber vor allem tatsächliche oder vermeintliche Gegner des
importierten sowjetischen Gesellschaftssystems ohne gerichtlichen
Schuldnachweis und auf unbestimmte Zeit gefangen. Die Haftbedingungen waren
unmenschlich, etwa 30% der Gefangenen starb an Hunger und Folgekrankheiten.
Von den Häftlingen am schlimmsten empfunden wurde das Hauptziel der Lager,
„die totale Isolation“ der Häftlinge und das Verbot jeglicher, insbesondere geistiger
Betätigung.
Über die Existenz der Lager war kaum etwas bekannt, in der DDR waren sie ein
Tabu-Thema. Nach der Offenlegung eines Teils der Akten des sowjetischen
Geheimdienstes NKWD in der Zeit nach der „Wende“ 1989 / 1990 begann eine
wissenschaftliche Erforschung des Systems dieser Lager, ihrer Ziele und
Grundlagen.
Zum Thema Musik und kulturelle Aktivitäten in den Speziallagern – ein
Erfahrungsbereich, der den Lebensalltag der Gefangenen dieser Lager
entscheidend prägte – gab es zum Zeitpunkt des Forschungsbeginns dieser Arbeit
keinerlei Untersuchungen.
Diese Lücke wird mit dieser Arbeit im Rahmen des auffindbaren Materials aus
einschlägigen Archiven in Deutschland und in Moskau sowie aus im Privatbesitz
befindlichen Berichten, Noten und weiteren Dokumenten, die durch eigene
Zeitzeugeninterviews ergänzt wurden, geschlossen.
Erstmals wird ein Gesamtüberblick über alle zehn sowjetischen Speziallager zur
Thematik „Musik, Kultura und kulturelle Betätigung“ mit detaillierter Untersuchung
der lagerübergreifenden sowie der lagerspezifischen Phänomene bei gleichzeitiger
Einordnung in den jeweiligen historischen Kontext gegeben.

K. Borrmann
Bode Quartett
ist Preisträger der Musikakademie Rheinsberg und erhält ein Arbeitsstipendium für die
Aufnahme unveröffentlichter Kompositionen aus den Speziallagern der sowjetischen Besatzungsmacht
Werke von Hans Wolfgang Sachse
29.03.2021
Musikakademie Rheinsberg
mit freundlicher Unterstützung des Stipendienprogramms der Musikkultur Rheinsberg gGmbH
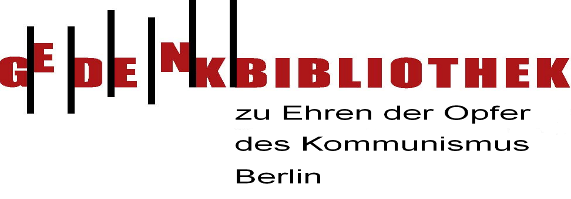
Berlin, Di. 5. Februar 2019, 18.00
Anna Barbara Kastelewicz,
die Violinistin, Konzertmeisterin und Musikwissenschaftlerin hält ihren Vortrag mit Musik zum Thema:
Musik in den sowjetischen Speziallagern
Von 1945 bis 1950 inhaftierte die sowjetische Besatzungsmacht insgesamt weit über 120.000 Personen in 10 sogenannten Speziallagern mit totaler Isolation der Gefangenen gegenüber der Außenwelt.

© J.Rötzsch
Jede sinnvolle geistige Tätigkeit war streng verboten. Trotz des Verbots gab es vielfältige heimliche, teils geduldete musikalische und andere kulturelle Betätigungen der Häftlinge (Singen, selten Musizieren mit behelfsmäßigen Instrumenten, Vorträge, Gedichte, Kunsthandwerk (etc.), um vor allem der geistigen Verödung zu entgehen. Im (offensichtlichen oder scheinbaren) Widerspruch zu diesem Verbot gab es die offizielle „Kultura“ und in deren Rahmen u. a. Konzerte und Theateraufführungen von Häftlingen.
Ort: Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des Kommunismus
Nikolaikirchplatz 5-7
10178 Berlin
Anna Barbara Kastelewicz präsentiert auf der Internationalen Konferenz
Music and the Nation III
MUSIC IN POSTWAR TRANSITIONS
(19th-21st Centuries), International Conference, Montreal, 18-20 October 2018
Die Teilnahme an der Konferenz wird gefördert durch Stipendien von:
research team « Musique en France aux XIXe et XXe siècles » (OICRM), Université de Montréal, Faculté de Musique
Kastelewicz, Anna Barbara – Mozarteum University Salzburg präsentiert am 19.Oktober 2018:
« Conquerors and Conquered : Music and Kultura in the Soviet Special Camps in Germany, 1945-1950 »
http://musiqueetsortiesdeguerres.org/en/call-for-papers/
The end of a war does not necessarily coincide with the signing of a peace treaty. This premise underlies the notion of the postwar transition, developed by historians over the past two decades. Contrary to traditional diplomatic history, research on postwar transition periods considers the restoration of peace as a dynamic and complex process involving different simultaneous temporalities. Traces of conflict continue to affect societies long after the negotiation of peace. These traces are explored from four angles: 1) the reopening of borders and the return of soldiers, prisoners, and exiles; 2) the reinterpretation of the image of the enemy; 3) memory of the conflicts; 4) ‘cultural demobilisation’. The latter concept provides an opportunity to explore the various paces within postwar transitions: the alleviation of physical and symbolic violence, the momentum produced by pacifist ideals, the rehabilitation of the enemy as well as mourning and grieving processes.
Although the role of art has been explored in recent work on the topic, music has yet to receive any attention. However, the transition from war to peace can be observed in the reconstruction of musical milieus and in musical production. Musical creation, practices, and sociability, the establishment of new repertories, and the resumption of symbolic works can facilitate—or delay—the process of cultural demobilization. The “Music and Postwar Transitions” conference presents an exceptional opportunity to fill this historiographical lacuna.
Copyright http://musiqueetsortiesdeguerres.org/en/call-for-papers
Informationen zur Konferenz:
http://musiqueetsortiesdeguerres.org/en/home/
Informationen zum Programm:
http://musiqueetsortiesdeguerres.org/en/program/
Die musikwissenschaftliche Arbeit wird gefördert durch Stipendien von der Universität Mozarteum Salzburg und der AKB Stiftung Einbeck.
Musik in den sowjetischen Speziallagern
Vom Kriegsende 1945 an bis 1950 inhaftierte die sowjetische Besatzungsmacht insgesamt weit über 100.000 Personen in besonderen Lagern, den Speziallagern Nr. 1 – 10.
Das Besondere dieser Lager war die totale Isolation der Gefangenen gegenüber der Außenwelt – es waren sogenannte „Schweigelager“. Jeder Kontakt nach außen oder zu Angehörigen, der Besitz von Papier und Bleistift, jede sinnvolle geistige Tätigkeit (außer Schachspielen) waren streng verboten. Lediglich in Arbeitskolonnen zur Aufrechterhaltung des Lagerbetriebs war eine Betätigung für wenige Häftlinge möglich. Die verordnete Inaktivität bedeutete zusätzlich eine extreme psychische Belastung, die die physische Not durch Hunger und Krankheit noch verstärkte. Die Todesrate lag bei etwa 30%.
Trotz des Verbots gab es vielfältige heimliche, teils geduldete musikalische und andere kulturelle Betätigungen der Häftlinge (Singen, selten Musizieren mit behelfsmäßigen Instrumenten, Vorträge, Gedichte, Kunsthandwerk etc.), um vor allem der geistigen Verödung zu entgehen.
Im (offensichtlichen oder scheinbaren) Widerspruch zu diesem Verbot gab es die offizielle „Kultura“, in deren Rahmen Konzerte, Theateraufführungen und andere Veranstaltungen von inhaftierten Künstlern, oft auf höchstem Niveau, stattfanden, zunächst für das sowjetische Lagerpersonal, später auch für die Häftlinge zugänglich.
Anna Barbara Kastelewicz erschließt das Quellenmaterial. Wenige Noten haben zum Teil als Stimmen-Überreste überlebt. Dieser seltene Schatz wird gesichert, aufgearbeitet, analysiert, ergänzt und arrangiert und in moderierten Konzerten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Vortrag zum Mahn- und Gedenktreffen am Lager Mühlberg
09.09.2016
Anna Barbara Kastelewicz:
“Kultura” im sowjetischen Speziallager Nr. 1 Mühlberg / Elbe
© Karsten Bär
mit freundlicher Genehmigung:
Ein Artikel ist in der Zeitschrift “Der Stacheldraht” Nr.6/2015 erschienen über die Erinnerungsveranstaltung zum 70. Jahrestag der Einrichtung des NKWD Lagers Nr.9.
Anna Barbara Kastelewicz hielt bei der Veranstaltung einen Vortrag zu ihrer Arbeit.

